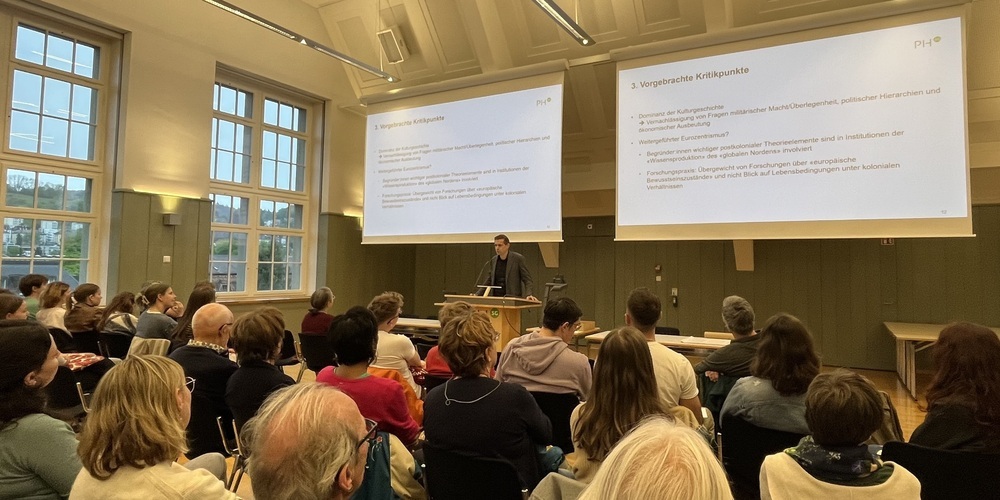Passend zum Themenmonat «Konquistadoren und Sklavenhändler: Kolonialgeschichte in der Bodenseeregion» des Stadtarchivs St.Gallen und der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen (siehe Box) widmete sich die Focus-Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) vom Montag, 6. Mai 2024, dem postkolonialen Blick auf die Schule und die Lehrpersonenbildung.
«Auch in Ländern ohne koloniales Erbe wie der Schweiz ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig, da die kolonialen Strukturen und Denkmuster in den globalen Bildungssystemen nach wie vor präsent sind», sagte Prof. Dr. Nicolas Robin, Prorektor Ausbildung der PHSG.
Zeitgemässe Lehrpersonenbildung
Allerdings hätten in den vergangenen Jahren postkoloniale Zugänge für viele Fachdisziplinen stark an Bedeutung gewonnen und rückten zunehmend in den Blick der Öffentlichkeit. Deshalb gehörten entsprechende Perspektiven auch zu einer zeitgemässen, diversitätssensiblen, diskriminierungskritischen Schule und Lehrpersonenbildung.
«In der Ausbildung der Lehrpersonen kann eine postkoloniale Perspektive dazu beitragen, Sensibilität für die vielfältigen kulturellen Hintergründe der Schüler zu entwickeln und sie auf die Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft vorzubereiten», so Robin.
Ein Projekt «der anderen»
Noch sei die postkoloniale Perspektive hinsichtlich Geschichte im aktuellen Lehrplan und in den Lehrmitteln «nicht wirklich» angekommen, sagte Prof. Dr. Thomas Metzger, Dozent Fachbereich Räume, Zeiten, Gesellschaften (Geschichte) und Co-Leiter der Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrechte der PHSG.
«Die postkoloniale Forschung – auch in der Schweiz – der 2000er-Jahre wurde in der Genese des Lehrplans 21 und den darauf aufbauenden Geschichtslehrmitteln kaum rezipiert. Eurozentrische Deutungen und Periodisierungen bleiben dominant.» In der Schweiz werde Kolonialismus noch immer vor allem als Projekt «der anderen» gesehen. «Es braucht spezifisch ergänzende Angebote zu den etablierten Lehrmitteln.»
Für Metzger ist denn auch wichtig, dass Studenten mit der postkolonialen Perspektive in Kontakt kommen. «Dabei ist ein qualifizierter Umgang mit Quellen nötig. Es darf keine Reproduktion des kolonialen Blicks und Denkens sein.» In seinem Fachbereich an der PHSG gebe es Module, die einen postkolonialen Blick auf die Geschichte werfen, wie «Geschichte der Schweiz – Vertiefung», das die transnationale Dimension von Schweizer Geschichte behandelt, oder «Geschichte der Dekolonisation».
Alte Geschichten neu erzählen
Auch im Fachbereich Ethik, Religionen, Gemeinschaft findet in der Lehrpersonenausbildung eine Auseinandersetzung mit dem Thema statt. «Alte Geschichten können und müssen anders erzählt werden», sagte Dr. Rolf Bossart, Dozent Fachbereich Ethik, Religionen, Gemeinschaft und Leiter des Instituts Gesellschaftswissenschaftliche Bildung der PHSG.
Deshalb lernten PHSG-Studenten, Widersprüche wahrzunehmen und kritisch zu sein – gegenüber alten und neuen Positionen. «Denn wenn traditionelle Geschichten immer nur einen Teil der Wahrheit wiedergeben, oft Falsches enthalten und Wichtiges verdrängen, dann ist zu vermuten, dass jede neue Geschichte wieder ähnliche Probleme hat», ist Bossart überzeugt.
Diese Mehrperspektivität bedeute nichts anderes, als beweglich zu bleiben und den blinden Fleck der aktuellen Ansicht immer wieder durch das Variieren der eigenen Position aufzudecken.