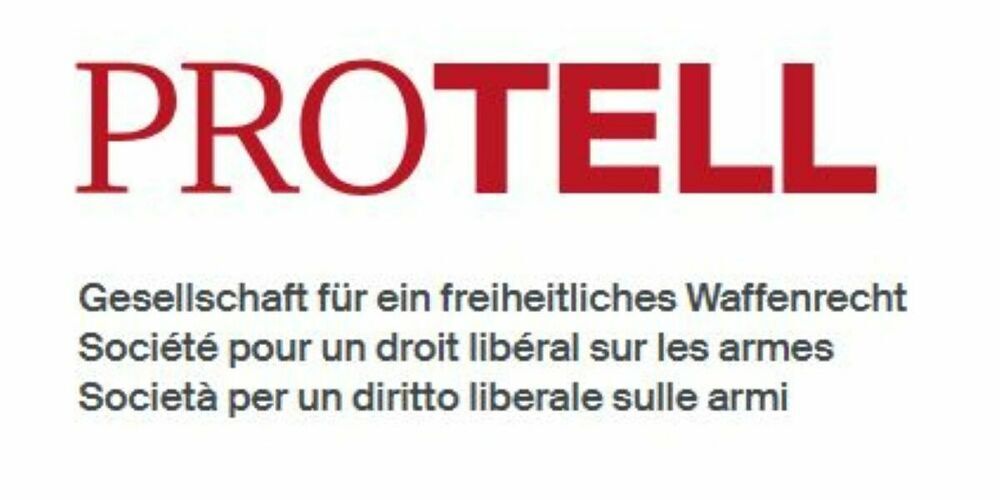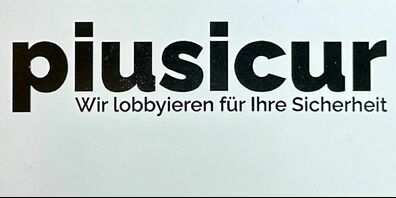Unrecht. Freiheitsfeindlich. Nutzlos. Gefährlich. Antischweizerisch. Mit diesen fünf Schlagworten hat PROTELL gemeinsam mit Partnerorganisationen vor fünf Jahren vor der Verschärfung des Waffengesetzes gewarnt. Es ist Zeit, eine Bilanz zu ziehen – hat sich die Warnung bewahrheitet?
Am 13.11.2015 regierte in Paris die Barbarei. Mit illegal beschafften und quer durch den Kontinent gekarrten Kalaschnikow-Sturmgewehren südosteuropäischer Herkunft wurde in einem Konzert ein grauenhaftes Blutbad angerichtet. Die Täter waren französischer oder belgischer Nationalität, stammten jedoch aus nordafrikanischen Staaten und waren radikalislamistisch motiviert. Das weltweite Entsetzen entlud sich in Solidaritätsbekundungen mit der durch Terrorismus bereits arg gebeutelten Stadt. Die EU reagierte mit einer Verschärfung der sogenannten Waffenrichtlinie, welche als Mindeststandard für die Gesetzgebung der Mitgliederländer verbindlich ist. Davon war auch die Schweiz betroffen, denn sie ist als Schengen-Staat zur Rechtsübernahme verpflichtet.
Alsbald ging in Bundesbern die Angst um, die Mitgliedschaft in Schengen zu riskieren, sollte die Verschärfung nicht ins hiesige Waffengesetz übernommen werden. Eine Verschärfung, die notabene auf ein spezifisch französisches Sicherheitsproblem abzielte und mit der Realität in der Schweiz keinerlei Zusammenhang hat. So wurde denn auch die Kampagne von Bundesrat, Wirtschaftsverbänden und allen Parteien (ausser der SVP) geführt: Es wurde gar nie bestritten, dass eine Verschärfung für die Schweiz nutzlos ist. Vielmehr wurde mit einem «automatischen» Schengen-Austritt gedroht. Nur, mit dieser Position widersprach sich der Bundesrat selbst. Als es 2005 um den Schengen-Beitritt ging, hat er nämlich versichert, dass die Nichtübernahme von Verschärfungen nur «im äussersten Fall» zu einem Austritt führen würde. Zudem hat er versprochen, dass keine «einschneidende Beschränkungen in unserem Waffenrecht» eingeführt werde. Angst gemacht wurde mit dem Verlust der Sicherheit und der Reisefreiheit. Es konnte der absurde Eindruck entstehen, beides bestünde erst, seit unser Land bei Schengen mitmachen darf.
So hat das Schweizervolk am 19.05.2019 der Verschärfung zugestimmt und damit mehrere Tatsachen geschaffen:
- Vierzehn Jahre reichen aus, um schriftliche Zusicherungen im Abstimmungsbüchlein ungültig werden zu lassen.
- Eine Mehrheit hat signalisiert, dass Waffenrecht eine staatspolitische Nebensache ist. Weshalb dies völlig falsch ist, dazu folgt weiter unten mehr.
- Schengen ist eine dermassen heilige Kuh, dass sie nicht einmal in die Nähe einer Gefahr geführt werden darf.
- Die Schweiz ist sich ihrer sicherheits- und verkehrsstrategischen Bedeutung im Herzen Europas sowie als Arbeitgeberin von 300'000 Grenzgängern offenkundig nicht bewusst.
- Die wichtige und sicherlich traditionsreichste Breitensportart im Land, das Schiessen auf 300 Meter, wird künftig grösstenteils mit verbotenen Waffen ausgeübt.
Brüssel dürfte es gefreut haben – illiberale Kräfte in Bern auch – nur die ordnungspolitische Vernunft blieb auf der Strecke. Denn das Prinzip, dass unnötige Gesetze abzulehnen sind, wurde mit Füssen getreten. Ebenso wurde der Umstand, dass in der Schweiz das Volk der Souverän ist und folglich per Definition ein Recht auf Waffenbesitz hat, als unbequeme staatspolitische Tatsache beiseite gefegt. So verkommt die Bundesverfassung zur Makulatur: wer seine Freiheit nicht gebraucht, ist nicht frei.
Nebst diesen staatsphilosophischen Problemen sind auch handfeste Auswirkungen der Verschärfung zu beklagen. Schliesslich ist die Schweiz ein Rechtsstaat und geltende Gesetze werden angewendet. Auch unbescholtene, langjährige Waffenbesitzer werden bestraft, wenn sie in Unkenntnis der geltenden Regeln die Waffe mit der «falschen» (sprich: altrechtlich korrekten) Bewilligung erwerben oder veräussern. So werden durch gesetzgeberische Manöver gesetzestreue Bürger ohne jegliche kriminelle Energie zu Vorbestraften gemacht und die Strafverfolgung mit Trivialitäten belastet.
Zu den eingangs erwähnten Schlagworten gesellen sich also zwei weitere hinzu: kriminalisierend und mutlos. Auf diese Weise präsentiert sich eine bürokratische und verzagte Version der Schweiz, die ihre Stärken, Traditionen und die Freiheit des Individuums aufs Spiel setzt. Wer eine solche Vision unseres Landes hat, befeuert autoritäre Tendenzen – eine Krankheit unserer Zeit.