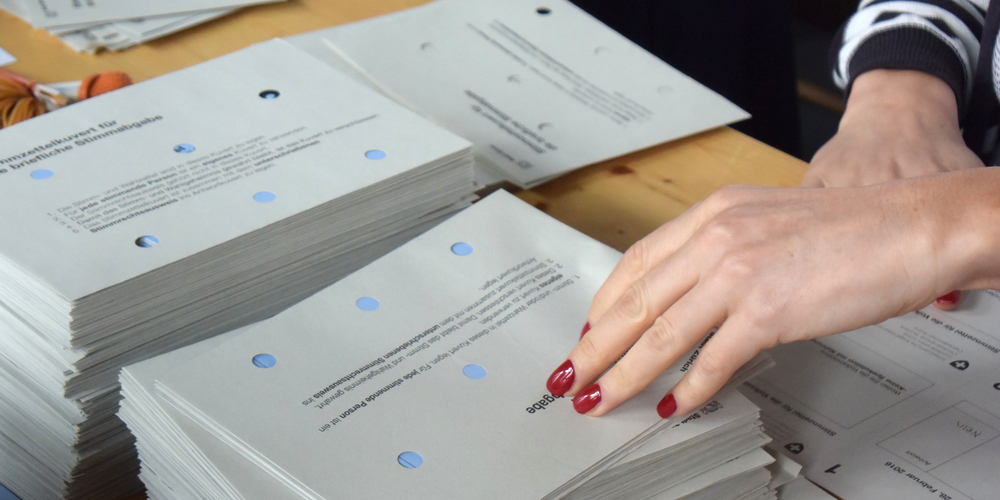Kostenbremse-Initiative
In der Schweiz soll eine Kostenbremse für die Krankenversicherung eingeführt werden, sodass die Kosten nicht stärker steigen als die durchschnittlichen Löhne. Jede Person muss eine Grundversicherung abschliessen und dafür eine Prämie zahlen, die einen Teil der medizinischen Kosten abdeckt. Die Preise für medizinische Leistungen werden von Krankenkassen und Leistungserbringern festgelegt und müssen von den Behörden genehmigt werden. Seit der Einführung der Krankenversicherung sind die Gesundheitskosten und Prämien stark gestiegen, unter anderem wegen neuer Behandlungsmöglichkeiten. Eine Volksinitiative fordert nun die Einführung einer Kostenbremse, über die abgestimmt wird. Der Bundesrat und das Parlament haben einen Gegenvorschlag erarbeitet. Wird die Initiative angenommen, sorgt der Bund dafür, dass die Kosten der Grundversicherung nicht mehr als 20 Prozent stärker steigen als die durchschnittlichen Löhne. Falls dieser Unterschied überschritten wird, müssen Bund und Kantone Massnahmen ergreifen. Der Gegenvorschlag sieht vor, dass der Bundesrat ein maximales Wachstum der Gesundheitskosten festlegt, unter Einbezug der Meinungen von Kantonen, Leistungserbringern und Versicherungen. Jeder Kanton erhält ein eigenes Kostenziel, das auf mehrere Blöcke aufgeteilt wird. Wird ein Kostenziel überschritten, prüfen Bundesrat oder Kantonsregierung notwendige Massnahmen. Erfolgt eine Ablehnung, unterliegt der Gegenvorschlag dem fakultativen Referendum. Werden innerhalb von 100 Tagen 50 000 Unterschriften gesammelt, wird darüber abgestimmt. Sonst tritt der Gegenvorschlag in Kraft.
Prämienentlastung-Initiative
In der Schweiz sollen alle Versicherten maximal zehn Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Krankenkassenprämien aufwenden müssen. Seit 1996 übernimmt die Krankenkasse die Gesundheitskosten, eine Krankenversicherung ist Pflicht. Die Versicherten zahlen Prämien, die stetig steigen, um die Gesundheitskosten zu decken. Wer sich die Prämien kaum leisten kann, kann Prämienverbilligungen beantragen. Deren Höhe und Verfügbarkeit variieren je nach Kanton. Die Finanzierung der Verbilligungen wird zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt, wobei der Bund die Anpassung an die Gesundheitskosten vornimmt und die Kantone den Umfang selbst bestimmen können. Es wurde eine Volksinitiative eingereicht, die fordert, dass niemand mehr als zehn Prozent seines verfügbaren Einkommens für Prämien zahlen muss.
Wird die Initiative angenommen, legt das Parlament fest, wie das verfügbare Einkommen berechnet wird. Liegt die Prämie über der Zehn-Prozent-Grenze, übernimmt eine Prämienverbilligung den Rest. Bund und Kantone müssten die Verbilligungen deutlich erhöhen, wobei der Bund mindestens zwei Drittel der Kosten trägt. Die zusätzlichen jährlichen Kosten werden auf 3,5 bis 5 Milliarden Franken geschätzt.
Der Bundesrat und das Parlament haben einen Gegenvorschlag erarbeitet: Steigen die Gesundheitskosten, erhöht der Bund automatisch die Prämienverbilligungen. Auch die Kantone sollen ihre Beiträge automatisch anpassen. Jeder Kanton muss einen Mindestbeitrag zur Prämienverbilligung leisten, abhängig von den kantonalen Kosten der Grundversicherung. Die Kantone müssen jährlich mindestens 360 Millionen Franken mehr zur Prämienverbilligung beitragen. Die Kantone legen fest, wie hoch die Prämie im Vergleich zum verfügbaren Einkommen maximal sein darf. Diese Regelung kann kantonal variieren.
Einige Kantone erfüllen bereits Teile des Gegenvorschlags. Die Kosten des Gegenvorschlags tragen die Kantone, für den Bund entstehen keine zusätzlichen Kosten. Wird die Initiative abgelehnt, tritt der Gegenvorschlag in Kraft, es sei denn, es wird ein Referendum ergriffen.
Initiative zur Körperlichen Unversehrtheit
Eingriffe in die körperliche und geistige Unversehrtheit einer Person sollen nur mit ihrer Zustimmung erfolgen dürfen. Erteilt eine Person keine Zustimmung, darf sie keine Nachteile erfahren oder bestraft werden. In der Bundesverfassung ist festgehalten, dass jeder Mensch das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit hat. Dieses Recht darf nur im Rahmen des Gesetzes eingeschränkt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder die Grundrechte einer anderen Person gefährdet sind. Beispiele dafür sind polizeiliche Durchsuchungen oder Festnahmen von Verdächtigen.
Während der Corona-Pandemie galten einige Einschränkungen nur für ungeimpfte Personen, wie etwa der Zutritt zu Restaurants. Ein Teil der Bevölkerung betrachtet dies als Einschränkung ihres Rechtes auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Eine Volksinitiative wurde eingereicht, die fordert, dass dieses Recht in der Bundesverfassung genauer festgelegt wird. Deshalb wird darüber abgestimmt.
Falls die Volksinitiative angenommen wird, muss jede Person einem Eingriff in ihre körperliche und geistige Unversehrtheit zustimmen. Verweigert eine Person einen solchen Eingriff, darf sie weder gesellschaftlich noch beruflich benachteiligt oder bestraft werden. Dies bedeutet, dass die körperliche und geistige Unversehrtheit stärker geschützt wird und Eingriffe ohne Zustimmung nicht erlaubt sind.
Stromversorgungsgesetz
In der Schweiz soll mehr Strom aus erneuerbaren Energien produziert werden. Neue Regelungen und Unterstützungsmassnahmen sollen dies fördern. Im Winter importiert die Schweiz oft Strom aus dem Ausland, was wegen Krisen manchmal nicht möglich ist. Das Parlament möchte daher die inländische Stromproduktion durch erneuerbare Energien fördern und hat das «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien» beschlossen. Gegen dieses Gesetz wurde das Referendum ergriffen, weshalb nun darüber abgestimmt wird.
Wird die Vorlage angenommen, bringt das mehrere Änderungen: Wer Solaranlagen auf dem Dach oder an der Fassade installiert, erhält weiterhin finanzielle Unterstützung. Für Solarstrom, der ins Netz eingespeist wird, gibt es schweizweit einheitliche Mindestpreise. Innerhalb eines Quartiers kann neu mit selbst produziertem Solarstrom gehandelt werden. Generell dürfen in besonders schützenswerten Gebieten, wie Biotopen, keine Stromproduktionsanlagen gebaut werden. Es gibt jedoch Ausnahmen für Gebiete, die besonders geeignet sind. Windkraft- und Solaranlagen ab einer bestimmten Grösse werden von nationalem Interesse und profitieren von vereinfachten Planungsbedingungen, solange sie nicht in schützenswerten Gebieten geplant sind. Einige Wasserkraftwerke sollen neu- oder ausgebaut werden. Beim Bau müssen Biodiversität und Landschaft gefördert werden, und grosse Wasserkraftwerke müssen im Winter Wasser für die Stromproduktion aufsparen. Zusätzlich werden Energieeffizienz und Innovation gefördert.