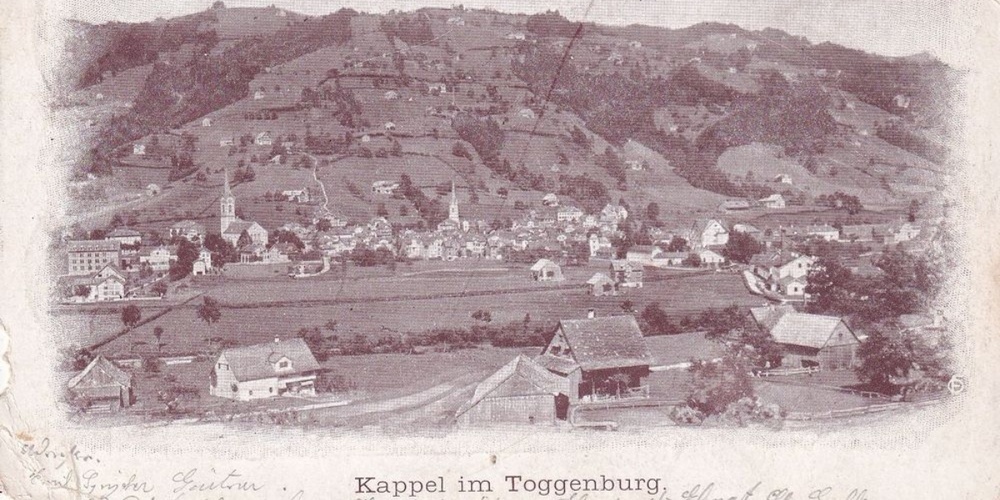„Meine Jugendzeit war reich an Freud und Leid, Hoffen und Streben, Wünschen und Wollen. Nicht grosse Begebenheiten, wohl aber ein bewegtes Innenleben füllten sie aus. (…) Nicht Eitelkeit mich zu bespiegeln soll meine Feder führen, sondern die dankbare Freude am genossenen Leben.“
„Auf dem Bauernhof heisst es arbeiten. Man hat jahraus jahrein gewöhnlich alle Hände voll zu tun. Da ist es denn auch nicht verwunderlich, dass auch die jugendlichen Arbeitskräfte frühzeitig zu Dienstleistungen herangezogen werden, und da in geweckten Kindern der Arbeits- und Nachahmungstrieb sich sehr früh geltend macht, so wird es von klugen Eltern auf das Nützliche hingeleitet.“
Lob und Brot als Lohn
So musste „Jörgli“ beispielsweise die Hühner vor der stets hungrigen Katze bewachen, Streusand klopfen, den Krug am Brunnen mit frischem Wasser füllen, dies und das erledigen. Der Lohn bestand manchmal aus einem Lob oder aus einem Stück Brot. 1861 bekam Johann Georg zum ersten Mal geregelte Arbeit zugeteilt. Er wurde als Viehhüter eingesetzt (Hagmann verglich sich mit Ulrich Bräker, der ja auch schon früh Hirte war) und ersetzte seinen Bruder Johann, der Sticker wurde. Hagmann musste später auch im Webkeller mithelfen.
Eppenberger, ein Dorfintellektueller
Eine wichtige Bezugsperson war dem Heranwachsenden der Buchbinder Eppenberger, der viel und genau las, ein gebildeter Mann, ja ein „Dorfintellektueller“ war. Eppenberger bewunderte den italienischen Freiheitshelden Giuseppe Garibaldi, nach dem bis heute in fast jeder italienischen Stadt ein Platz benannt ist. Eine wichtige Bezugsperson war auch der Onkel, der den Neffen das Fürchten lehrte, indem er ihm Gespenster- und Spukgeschichten erzählte. Leider wissen wir noch wenig über das vor alpine magische Weltbild es 19. Jahrhunderts. Der Glaube an Hexen und Geister dürfte aber mit der Aufklärung und dem Liberalismus nicht einfach ausgestorben sein, denn solche Mentalitäten sind langlebig.