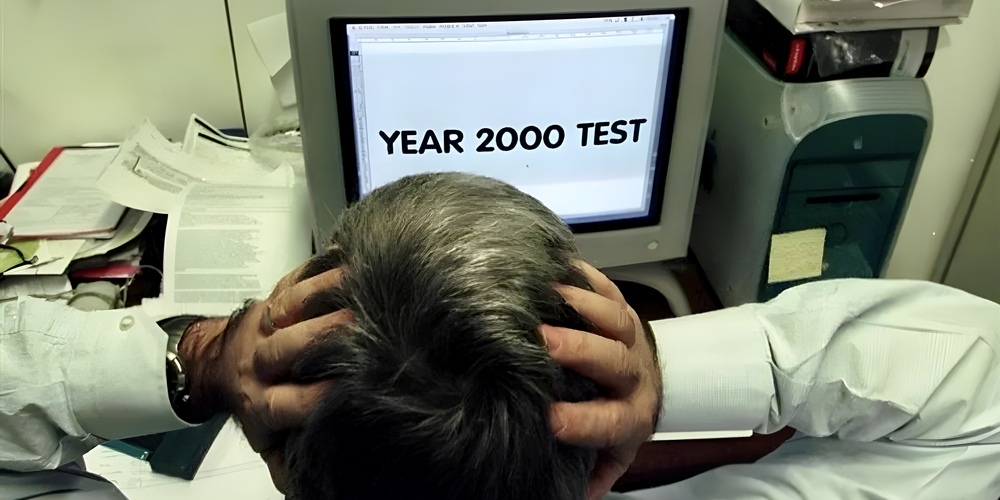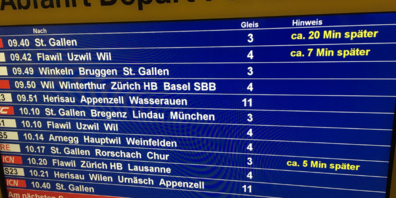In den 1990er-Jahren wächst die städtische Computer-Infrastruktur ständig, allerdings nicht immer in gelenkten Bahnen. Das städtische Netzwerk «franst» zunehmend aus, verschiedene Server befinden sich an unterschiedlichen Standorten, die untereinander ungenügend verbunden sind. Die Leistung reicht nicht aus, die Software ist veraltet. Ständige Wartezeiten bei Eingaben und häufige Systemabstürze sind die Folge. Der Unmut in der Stadtverwaltung wächst.
Mit dem Projekt «Netz2000» reagiert die Stadt auf die Probleme. Bei verschiedenen externen Partnern wird eine Studie in Auftrag gegeben. Der daraus abgeleitete Projektauftrag bestimmt die städtische Informatik in den kommenden Jahren. Es wird eine Zentralisierung der Computersysteme am Standort Rathaus beschlossen, die Behörden an anderen Standorten werden über standardisierte Netzwerkverbindungen angeschlossen. Die Software wird konsequent auf Microsoft umgestellt.
Das Jahr 2000 bringt eine zusätzliche Herausforderung. Die «Millenniumsangst» geht um den Globus. IT-Experten befürchten den Zusammenbruch der gesamten Computersysteme. Was war los? Desaströs könnte sich der Wechsel des Jahres 1999 zum Jahr 2000 auswirken. Seit den Anfängen des Computerzeitalters ist Speicher teuer. Die Informatikerinnen und Informatiker haben deshalb bei Datumsangaben oftmals die Zahl «19» und die Vorzeichen weggelassen, aus dem Datum 27.05.1983 wurde dann «830527».
Was geschieht nun beim Übertritt ins Jahr 2000? Nehmen wir an, ein Kind wird 1993 geboren. Im Jahr 1999 rechnet das System konsequent 99-93 = 6: das Kind ist also laut Datenbank sechs Jahre alt und soll eingeschult werden. Und im Jahr 2000? Das System rechnet 00-93 ohne negatives Vorzeichen: Das Kind ist laut Datenbank 93 Jahre alt und erhält Post von der Pro Senectute.
Dieser Fall mag noch harmlos sein, aber Unternehmer auf der ganzen Welt investieren in der Folge Milliardenbeträge, um diese Probleme zu beheben, denn sie betreffen Steuerungen an Maschinen, militärische Waffen, Geräte im Spital – kurz: alle Geräte, die in irgendeiner Weise mit Datumsangaben rechnen. Die IT-Abteilung der Stadt St.Gallen ist beim Jahreswechsel im Einsatz und überwacht die Geräte – und atmet erleichtert auf, als der Millenniumsabsturz nicht eintritt.
eGovernment, Cloud und OpenData – die städtische IT auf dem Weg ins 21. Jahrhundert
Am Ende der 2000er-Jahre stehen neue Herausforderungen an. Der Einsatz von Hardware und Software soll zunehmend nicht allein den städtischen Behörden dienen, sondern auch Bürgernähe herstellen und neue Dienstleistungsformate bereitstellen. Im Jahr 2008 wird dazu eine neue «eGovernment»-Strategie auf den Weg gebracht. Mit der Formel «von der Transaktion zur Interaktion» werden neue Online-Services vorgestellt. Städtische Dienstleistungen sollen für Bürgerinnen und Bürger 24 Stunden und 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen. Ein paar Jahre später kommt die OpenData-Plattform dazu, auf der Daten aus dem Verwaltungs- und Regierungshandeln transparent für jedermann einsehbar sind.
Im Jahr 2018 fusionieren die beiden Informatik-Unternehmen VRSG und Abraxas. Unter dem neuen Label Abraxas entsteht einer der grössten Schweizer Anbieter für IT-Lösungen für die öffentliche Hand. Stadtintern werden die Informatikdienste aufgebaut. Sie betreuen die städtischen Informatikmittel und IT-Infrastrukturen. Mit der «Cloud-first»-Strategie aus dem Jahr 2022 und der Einführung von Microsoft Teams als stadtweites Kollaborations-Werkzeug wird vermehrt auf die Zusammenarbeit in der Cloud gesetzt.
Schluss: «Die ich rief, die Geister» – Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz
Am Beginn des 21. Jahrhunderts digitalisieren wir unser Leben zunehmend, d. h., wir verwandeln unsere Welt in Zahlen und Codes, die von Maschinen gelesen und verarbeitet werden können. Davon erhoffen wir uns, die Welt für uns produktiver und überschaubarer zu machen. Unsere Welt, unsere sozialen Beziehungen, unser Leben ist in Computern im Taschenformat gespeichert. Unsere Smartphones sind mittlerweile mehr als nur technische Begleiter. Wir bauen eine persönliche Verbindung zu ihnen auf, schmücken sie mit Hüllen und Klebern, geben ihnen Namen, ärgern uns über sie, wollen sie ständig um uns haben.
Mit Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz (KI) sollen Maschinen in Zukunft Teile unseres eigenen Denkens übernehmen. Inwiefern intelligent? Diese Frage beschäftigt die Menschen seit den ersten Rechenmaschinen. Alan Turing hat in den 1950er-Jahren vorgeschlagen, eine Maschine dann als intelligent zu bezeichnen, wenn der Mensch nicht mehr entscheiden kann, ob sein Gegenüber ein Mensch oder eine Maschine ist. Intelligent wäre demnach eine Maschine, wenn sie sich intelligent verhält.
Mit Hilfe von Algorithmen und Trainingsdatensätzen bemühen wir uns, dem Computer die Welt beizubringen. Die Qualität des Verhaltens – oder die Intelligenz – der Maschine hängt von der Qualität dieser Eingaben ab. Als Googles «KI» lernen sollte, Menschen auf Bildern zu erkennen, liess man sie Tausende Bilder scannen, allerdings waren lediglich weisse Männer darauf zu sehen. Die KI klassifizierte in der Folge Männer mit schwarzer Hautfarbe als Gorillas.
Funktionierende KI nimmt uns mittlerweile viele Aufgaben ab: Sie liest Texte für uns und fasst sie zusammen, zeichnet Bilder, komponiert Musikstücke, nimmt Bestellungen an, versendet Pakete, tätigt Finanztransaktionen, ist an der Börse aktiv oder überwacht unseren Gesundheitszustand. Die «digitale Transformation» schafft neue Arbeitsweisen, -welten und -formen, und zerstört alte.
Entwickelt wurden Computer, um zu rechnen. Heute sollen sie uns die Welt erklären und das Denken abnehmen. Höchstwahrscheinlich werden wir uns Computer in Zukunft implantieren und Entscheidungen über unser Leben an sie abtreten. Nur eines sollten wir ihnen nicht überlassen: unsere Menschlichkeit.